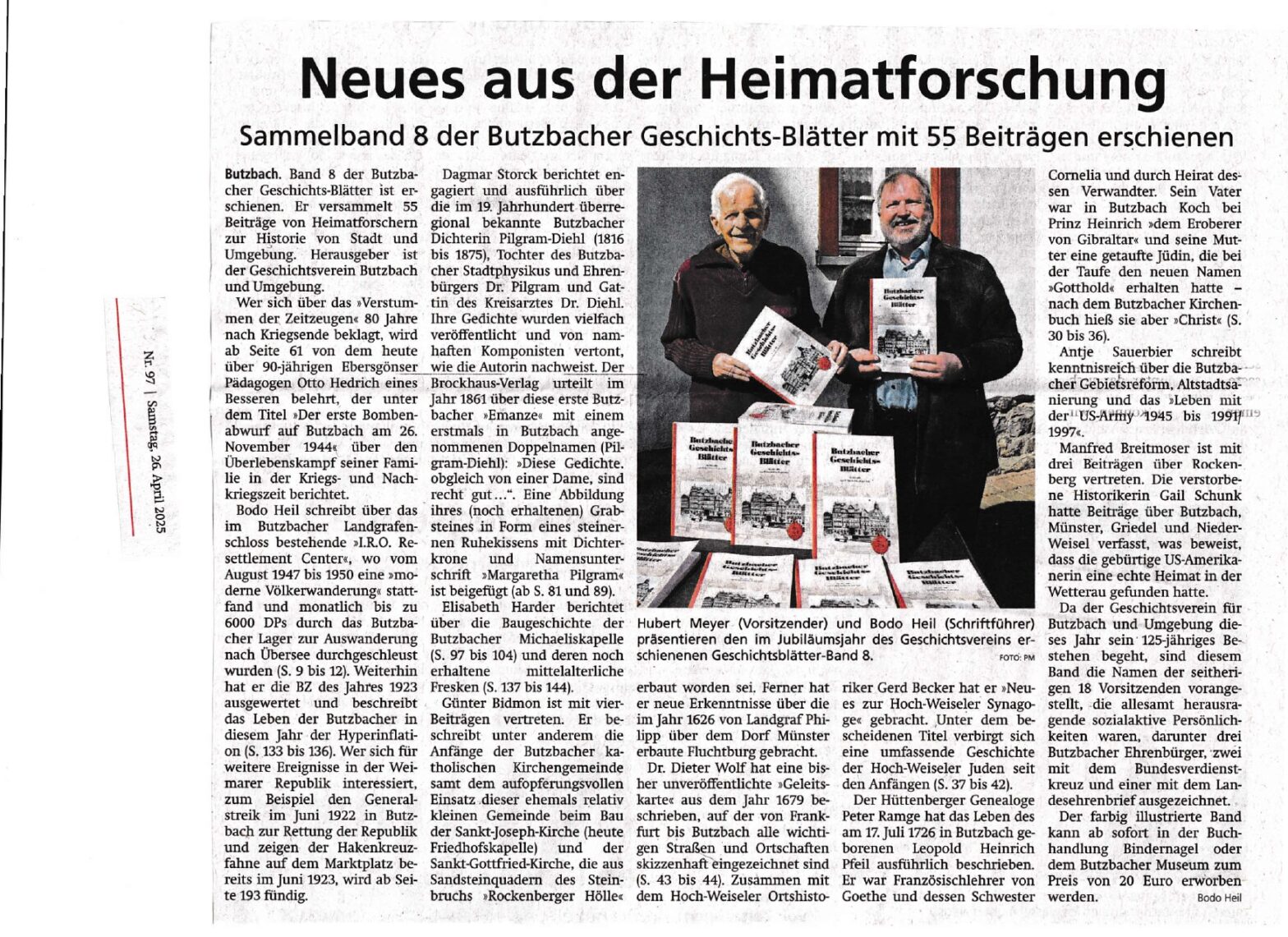Neues aus der Heimatforschung
Sammelband 8 der Butzbacher Geschichts-Blätter mit 55 Beiträgen erschienen
Butzbach. Band 8 der Butzbacher Geschichts-Blätter ist erschienen. Er versammelt 55 Beiträge von Heimatforschern zur Historie von Stadt und Umgebung. Herausgeber ist der Geschichtsverein Butzbach und Umgebung.
Wer sich über das »Verstummen der Zeitzeugen« 80 Jahre nach Kriegsende beklagt, wird ab Seite 61 von dem heute über 90-jährigen Ebersgönser Pädagogen Otto Hedrich eines Besseren belehrt, der unter dem Titel »Der erste Bombenabwurf auf Butzbach am 26. November 1944« über den Überlebenskampf seiner Familie in der Kriegs- und Nachkriegszeit berichtet.
Bodo Heil schreibt über das im Butzbacher Landgrafenschloss bestehende »I.R.O. Resettlement Center«, wo vom August 1947 bis 1950 eine »moderne Völkerwanderung« stattfand und monatlich bis zu 6000 DPs durch das Butzbacher Lager zur Auswanderung nach Übersee durchgeschleust wurden (S. 9 bis 12). Weiterhin hat er die BZ des Jahres 1923 ausgewertet und beschreibt das Leben der Butzbacher in diesem Jahr der Hyperinflation (S. 133 bis 136). Wer sich für weitere Ereignisse in der Weimarer Republik interessiert, zum Beispiel den Generalstreik im Juni 1922 in Butzbach zur Rettung der Republik und zeigen der Hakenkreuzfahne auf dem Marktplatz bereits im Juni 1923, wird ab Seite 193 fündig.
Dagmar Storck berichtet engagiert und ausführlich über die im 19. Jahrhundert überregional bekannte Butzbacher Dichterin Pilgram-Diehl (1816 bis 1875), Tochter des Butzbacher Stadtphysikus und Ehrenbürgers Dr. Pilgram und Gattin des Kreisarztes Dr. Diehl. Ihre Gedichte wurden vielfach veröffentlicht und von namhaften Komponisten vertont, wie die Autorin nachweist. Der Brockhaus-Verlag urteilt im Jahr 1861 über diese erste Butzbacher »Emanze« mit einem erstmals in Butzbach angenommenen Doppelnamen (Pilgram-Diehl): »Diese Gedichte, obgleich von einer Dame, sind recht gut…“. Eine Abbildung ihres (noch erhaltenen) Grabsteines in Form eines steinernen Ruhekissens mit Dichterkrone und Namensunterschrift »Margaretha Pilgram« ist beigefügt (ab S. 81 und 89).
Elisabeth Harder berichtet über die Baugeschichte der Butzbacher Michaeliskapelle (S. 97 bis 104) und deren noch erhaltene mittelalterliche Fresken (S. 137 bis 144).
Günter Bidmon ist mit vier Beiträgen vertreten. Er beschreibt unter anderem die Anfänge der Butzbacher katholischen Kirchengemeinde samt dem aufopferungsvollen Einsatz dieser ehemals relativ kleinen Gemeinde beim Bau der Sankt-Joseph-Kirche (heute Friedhofskapelle) und der Sankt-Gottfried-Kirche, die aus Sandsteinquadern des Steinbruchs »Rockenberger Hölle« erbaut worden sei. Ferner hat er neue Erkenntnisse über die im Jahr 1626 von Landgraf Philipp über dem Dorf Münster erbaute Fluchtburg gebracht.
Dr. Dieter Wolf hat eine bisher unveröffentlichte »Geleitskarte« aus dem Jahr 1679 beschrieben, auf der von Frankfurt bis Butzbach alle wichtigen Straßen und Ortschaften skizzenhaft eingezeichnet sind (S. 43 bis 44). Zusammen mit dem Hoch-Weiseler Ortshistoriker Gerd Becker hat er »Neues zur Hoch-Weiseler Synagoge« gebracht. Unter dem bescheidenen Titel verbirgt sich eine umfassende Geschichte der Hoch-Weiseler Juden seit den Anfängen (S. 37 bis 42).
Der Hüttenberger Genealoge Peter Ramge hat das Leben des am 17. Juli 1726 in Butzbach geborenen Leopold Heinrich Pfeil ausführlich beschrieben. Er war Französischlehrer von Goethe und dessen Schwester Cornelia und durch Heirat dessen Verwandter. Sein Vater war in Butzbach Koch bei Prinz Heinrich »dem Eroberer von Gibraltar« und seine Mutter eine getaufte Jüdin, die bei der Taufe den neuen Namen »Gotthold« erhalten hatte – nach dem Butzbacher Kirchenbuch hieß sie aber »Christ« (S. 30 bis 36).
Antje Sauerbier schreibt kenntnisreich über die Butzbacher Gebietsreform, Altstadtsanierung und das »Leben mit der US-Army 1945 bis 1991/1997«.
Manfred Breitmoser ist mit drei Beiträgen über Rockenberg vertreten. Die verstorbene Historikerin Gail Schunk hatte Beiträge über Butzbach, Münster, Griedel und NiederWeisel verfasst, was beweist, dass die gebürtige US-Amerikanerin eine echte Heimat in der Wetterau gefunden hatte.
Da der Geschichtsverein für Butzbach und Umgebung dieses Jahr sein 125-jähriges Bestehen begeht, sind diesem Band die Namen der seitherigen 18 Vorsitzenden vorangestellt, die allesamt herausragende sozialaktive Persönlichkeiten waren, darunter drei Butzbacher Ehrenbürger, zwei mit dem Bundesverdienstkreuz und einer mit dem Landesehrenbrief ausgezeichnet.
Der farbig illustrierte Band kann ab sofort in der Buchhandlung Bindernagel oder dem Butzbacher Museum zum Preis von 20 Euro erworben werden.
Hubert Meyer (Vorsitzender) und Bodo Heil (Schriftführer) präsentieren den im Jubiläumsjahr des Geschichtsvereins erschienenen Geschichtsblätter-Band 8. FOTO: PM
Nr. 97 | Samstag, 26. April 2025
Bodo Heil